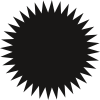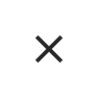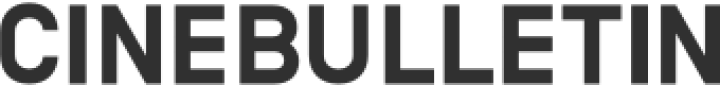Mit «Trading Paradise» hat ein politisch brisanter Film den 4. CH-Dokfilm-Wettbewerb gewonnen, Premiere
ist in Nyon. Wie der Film zustandekam und womit Daniel Schweizer zu kämpfen hatte.
Von Kathrin Halter
Maximilian Reimann, der SVP-Nationalrat, zeigt sich beeindruckt. Was Glencore in Peru leiste, sei überragend, auch wenn «ideologische NGOs» den Rohstoffgiganten mit Firmensitz in Baar regelmässig wegen Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen anklagen. FDP-Nationalrätin Doris Fiala dagegen sieht das grösste Problem von Glencore in der fehlenden Transparenz des Unternehmens; dem Vize vor Ort rät sie, offensiver zu kommunizieren.
Acht Mitglieder der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats sind nach Peru gereist, um sich ein Bild von den Geschäftspraktiken des Rohstoffmultis zu machen, der in Peru eine Kupfermine betreibt. Dabei hören sie sich auch einen Vertreter der lokalen Bevölkerung an, der die Politiker auf Umweltschäden hinweist.
Mit dabei war Daniel Schweizer (im Bild), der sich in «Trading Paradise» nicht nur dafür interessiert, was Bewohner im Umkreis der Mine, NGOs oder Glencores lokaler Chef zu den Praktiken des Rohstoffmultis sagen. Sondern auch dafür, wie sich die Geschäftsmethoden auf den Ruf unseres Landes auswirken. Dazu fährt er auch nach Sambia, wo Glencore eine weitere Kupfermine betreibt, und nach Brasilien, wo Ureinwohner gegen eine Mine mitten im Nationalpark und die Nickel-Verseuchung von Flüssen protestieren. Diese wird von Vale betrieben, einem weiteren Schweizer Rohstoffmulti mit Sitz in Lausanne. Der Genfer Regisseur versucht auch, mit den CEOs der beiden Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Doch dazu später.
Schnelles, unkompliziertes Arbeiten
Entstanden ist der Dokumentarfilm mit Hilfe des CH-Dokfilm-Wettbewerbs. Wie hat Daniel Schweizer die Kooperation mit seinen Förderern erlebt, hat diese seine Arbeit beeinflusst? Und was hält er von der Förderpraxis?
Der grösste Vorteil des Preises sei die Geschwindigkeit, mit der ein Film realisiert werden kann, sagt der Genfer Regisseur bei einem Treffen in Zürich. Insgesamt zwei Jahre habe er für das gesamte Projekt benötigt, vom ersten Treatment bis zum Final Cut – normalerweise daure das zwei bis drei Jahre länger.
Ein Nachteil, zumindest für ihn: Für einen Kinofilm, der zum grossen Teil im Ausland gedreht wird, sei der Beitrag von knapp 500ʼ000 Franken relativ bescheiden, zumal es untersagt bleibt, beim BAK oder anderswo weitere Gesuche zu stellen. So sah sich Schweizer gezwungen, die gewünschte Drehzeit zu verkürzen und mit einer reduzierten Crew zu arbeiten; in Brasilien zum Beispiel war Schweizer mit seinem Kameramann alleine unterwegs und war auch noch für den Ton zuständig. Zudem hätte er gerne noch mehr Zeit mit den Protagonisten verbracht.
Im Frühling 2014 hat Schweizer zusammen mit seinem Produzenten Valentin Greutert ein Treatment eingesandt. Dass es in der 4. Ausschreibung keine thematische Vorgabe gab, kam dem Regisseur entgegen. Die Idee zu «Trading Paradise» hat sich aus seiner vorherigen Arbeit heraus ergeben: «Dirty Paradise» (2009) handelt von der Goldgewinnung im Amazonas und ihre Folgen für die Indigenen und das Ökosystem, «Dirty Gold War» (2015) von der Goldindustrie. «Trading Paradise» bildet nun den Abschluss einer Trilogie über Rohstoffhandel und die Schweiz.
Viel Freiheit, keine Einmischung
Wie zwei weitere Filmschaffende, Ufuk Emiroglu und François Kohler, hat Schweizer im Sommer 25ʼ000 Franken für die Ausarbeitung des Treatments zur Produktionsreife gewonnen. Die Unterstützung machte es möglich, für Recherchen und die Erkundung von Drehorten nach Südamerika zu reisen. Bei der Präsentation des Projekts im Dezember erklärte er der Jury sein Konzept mit Hilfe von Fotos von den Recherchereisen; zum Dossier gehört auch ein Budget sowie ein erster Auswertungsplan. Damit gewann Schweizer die zweite Runde des Wettbewerbs, und somit 480ʼ000 Franken für die Fertigstellung des Films; Preisverleihung war wie immer an den Solothurner Filmtagen, gefolgt von einem Vertragsabschluss (worin, unter anderem, die Rechte am Film an den Produzenten gehen).
Im März 2015 waren Drehvorbereitungen, im April bereits Drehbeginn: Nach ersten Aufnahmen in Lausanne (von Demonstrationen vor dem Firmensitz von Vale) ging es im Sommer nach Brasilien, im September dann nach Sambia. Letzte Aufnahmen entstanden im Januar am WEF in Davos. Für die Montage nahm man sich dann etwa ein Jahr lang Zeit.
Sehr geschätzt hat Schweizer die Freiheit, die ihm gewährt worden ist, ein grosser Respekt auch seiner Arbeit gegenüber: «Es brauchte schon Mut, einen solchen Film zu unterstützen.» Dabei sei er von Anfang an ganz offen gewesen, worum es ihm geht.
In der Wettbewerbs-Phase gab es zwei Beratungssitzungen mit der damaligen Projektverantwortlichen Nicole Hess; später ein Feedback mit ein paar Anregungen nach einer Rohschnittvisionierung mit Regula Wolf und Nadine Adler vom Migros-Kulturprozent sowie Urs Augustburger und Sven Wälti von der SRG. Inhaltlich eingemischt hätten sich die Projektverantwortlichen jedoch nie. Diese begreifen ihre Rolle ja auch als Förderer, nicht als Koproduzenten oder gar als Auftraggeber.
Die problematische Rolle von PR-Agenturen
Schwierig erwies sich hingegen der Versuch, mit den CEOs der beiden Rohstoff-Multis ein Gespräch zu führen. Während sich Glencore nach einem Treffen Schweizers mit einer Kommunikationsagentur sowie dem Anwalt von CEO Ivan Glasenberg dazu grundsätzlich bereit zeigte, kam von Vale eine Absage – auch aufgrund einer Empfehlung von Burson-Marsteller, der PR-Agentur. Ivan Glasenberg wiederum bestreitet vor der Kamera jegliche Menschenrechtsverletzungen oder ökologischen Probleme; selbstverständlich mussten alle Fragen zuvor vorgelegt werden, zudem waren beim Interview immer drei Kommunikationsverantwortliche im Saal. Auch brauchte Schweizer von der Firma eine Erlaubnis, in der Mine zu filmen; eine Bedingung für das Interview mit Glasenberg war Einsicht in das gedrehte Filmmaterial. Ein offener Dialog im Kräfteringen zwischen der Zivilgesellschaft und den grossen Firmen sei nicht mehr möglich, so die Schlussfolgerung von Schweizer. «On est dans un rapport de force entre la communication, faite par les entreprises, et le travail du cinéma, qui cherche la vérité au plus près».